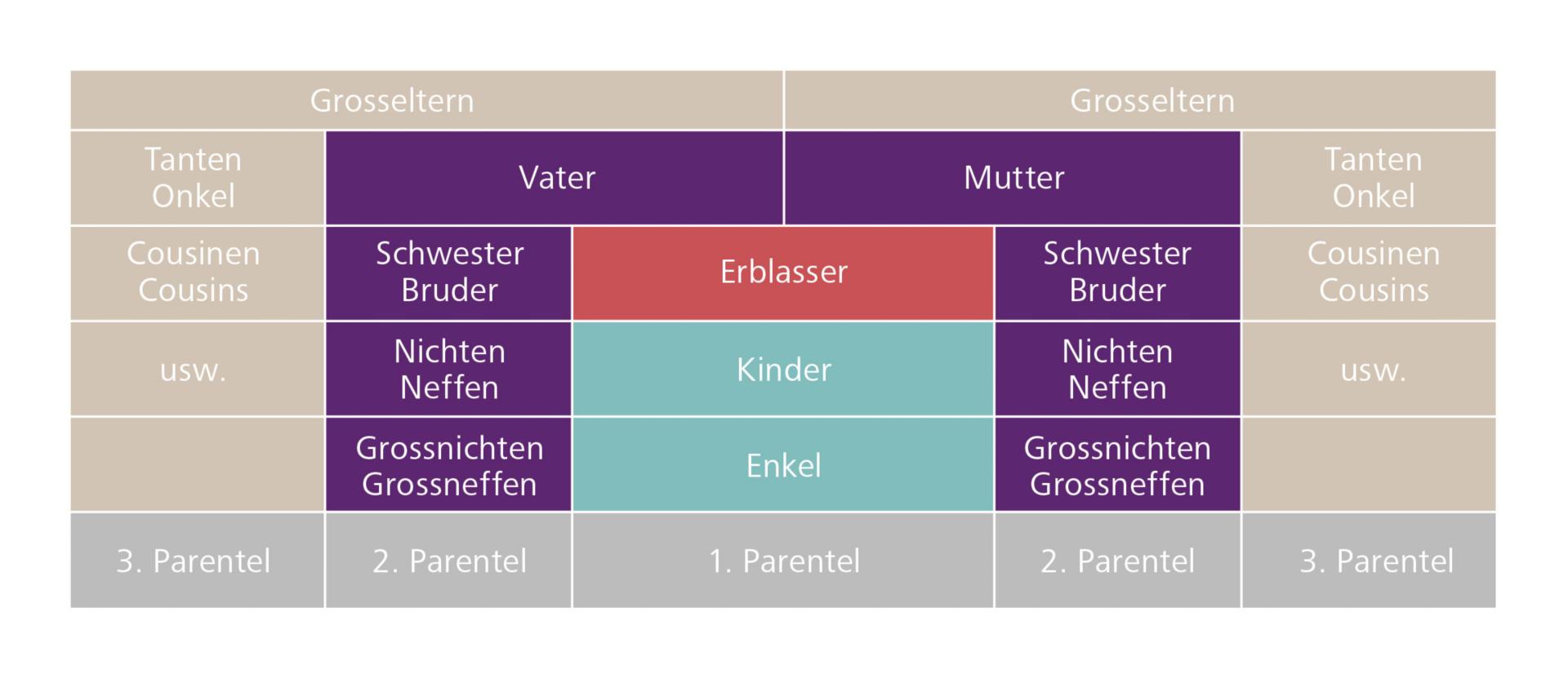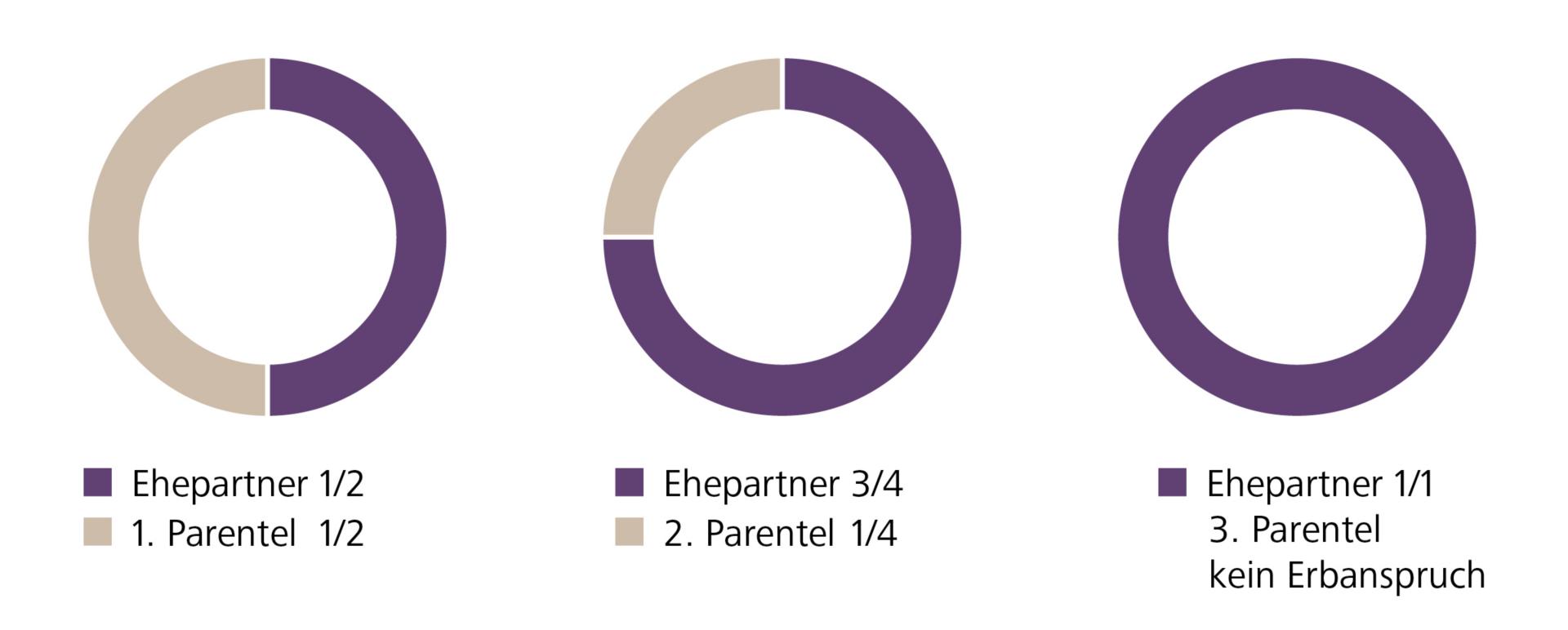Die publizierten Inhalte dienen ausschliesslich allgemeinen Werbe- sowie Informationszwecken und sind nicht auf die individuelle Situation des Empfängers abgestimmt. Der Empfänger bleibt selbst für entsprechende Abklärungen, Prüfungen und den Beizug von Spezialisten (z.B. Steuer-, Versicherungs- oder Rechtsberater) verantwortlich. Erwähnte Beispiele, Ausführungen und Hinweise sind allgemeiner Natur, welche im Einzelfall abweichen können. Aufgrund von Rundungen können sich sodann Abweichungen von den effektiven Werten ergeben.
Die Inhalte stellen weder eine Anlageberatung resp. persönliche Empfehlung noch ein Angebot, eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder zur Veräusserung von Finanzinstrumenten dar. Die Informationen sind insbesondere keinen Prospekt und kein Basisinformationsblatt gemäss Art. 35 ff. bzw. Art. 58 ff. FIDLEG dar. Die allein massgeblichen vollständigen Bedingungen sowie die ausführlichen Risikohinweise zu den erwähnten Finanzinstrumenten sind in den jeweiligen rechtsverbindlichen Verkaufsdokumenten (z.B. [Basis-]Prospekt, Fondsvertrag, Basisinformationsblatt (BIB) oder Jahres- und Halbjahresberichte) enthalten. Diese Unterlagen können kostenlos bei Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Raiffeisenplatz, 9001 St.Gallen oder unter raiffeisen.ch bezogen werden. Finanzinstrumente sollten nur nach einer persönlichen Beratung und dem Studium der rechtsverbindlichen Verkaufsdokumente sowie der Broschüre «Risiken im Handel mit Finanzinstrumenten» der Schweizerischen Bankiervereinigung (SBVg) erworben werden. Entscheide, die aufgrund der vorliegenden Inhalte getroffen werden, erfolgen im alleinigen Risiko des Empfängers. Aufgrund gesetzlicher Beschränkungen in einzelnen Staaten richten sich diese Informationen nicht an Personen mit Nationalität, Sitz oder Wohnsitz eines Staates, in welchem die Zulassung von den in diesem Inhalt erwähnten Finanzinstrumente oder Finanzdienstleistungen beschränkt ist. Bei den aufgeführten Performancedaten handelt es sich um historische Daten, aufgrund derer nicht auf die laufende oder zukünftige Entwicklung geschlossen werden kann.
Der vorliegende Inhalt enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese widerspiegeln Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen von Raiffeisen Schweiz zum Zeitpunkt der Erstellung. Aufgrund von Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren können die künftigen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Entsprechend stellen diese Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen und Entwicklungen dar. Zu den Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht der Raiffeisen Gruppe beschriebenen Risiken und Unsicherheiten.
Raiffeisen Schweiz sowie die Raiffeisenbanken unternehmen alle zumutbaren Schritte, um die Zuverlässigkeit der präsentierten Daten zu gewährleisten. Sie übernehmen aber keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der in diesem Inhalt veröffentlichten Informationen und haften nicht für allfällige Verluste oder Schäden (direkte, indirekte und Folgeschäden), die durch die Verteilung und Verwendung dieses Inhalts verursacht werden. Insbesondere haften sie nicht für Verluste infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken. Die in diesem Inhalt geäusserten Meinungen sind diejenigen von Raiffeisen Schweiz zum Zeitpunkt der Erstellung und können sich jederzeit und ohne Mitteilung ändern. Raiffeisen Schweiz ist nicht verpflichtet, diesen Inhalt zu aktualisieren. In Bezug auf allfällige, sich ergebende Steuerfolgen wird jegliche Haftung abgelehnt. Der vorliegende Inhalt darf ohne schriftliche Genehmigung von Raiffeisen Schweiz weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt und/oder weitergegeben werden.